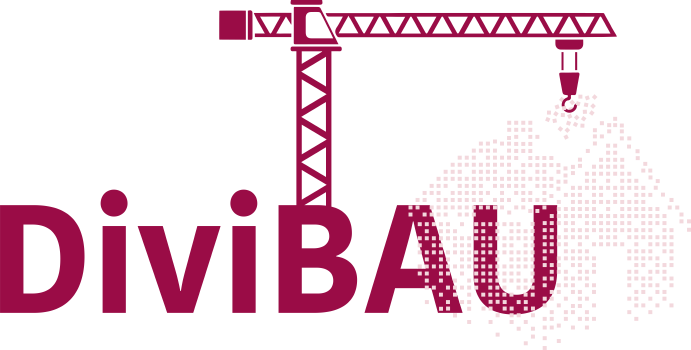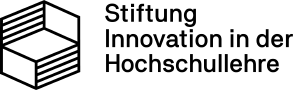Hier finden Sie weitere Informationen zum Thema "Planung und Dimensionierung von Kranen"
Hier finden Sie weitere Informationen zum Thema "Lastaufnahmeeinrichtungen"
Allgemeine Eigenschaften von Kranen
Der Kran dient als Hebegerät auf einer Hochbaustelle meist als wichtigstes Element der Baustelleneinrichtung. Er dient zum Transport von Materialien vom LKW zum Lager und zur Einbaustelle. Außerdem werden Krane zur Montage von Schalung, Bewehrung und Fertigteilelementen genutzt.
Kranarten
Auf Baustellen kommen unterschiedliche Kranarten zum Einsatz, die folgend tabellarisch zusammengefasst wurden. Nachfolgend wird der Auslegerdrehkran näher betrachtet, da dieser auf Baustellen am häufigsten zum Einsatz kommt.
| Kranart | Definition |
|---|---|
| Brückenkran | Brückenkrane laufen auf Schienen, die auf Stützenkonsolen befestigt sind. Entlang der Brückenachse lässt sich die Flasche mit Haken frei fahren. Besonders in der stationären Fertigung wie in Fertigteilwerken, in Betonfertigteillagern oder Werkstätten kommen Brückenkrane zum Einsatz. Auf Baustellen werden sie nur sehr selten eingesetzt. |
| Portalkran | Auch Portalkrane laufen auf zwei Schienen, welche im Gegensatz zum Brückenkran jedoch nicht auf dem Boden befestigt sind. Unter der Kranbrücke ist sind Stützen angeordnet. Portalkrane kommen insbesondere auf Freiflächen wie z.B. auf Außenlagern von Fertig-teilwerken oder der Betonstahlbearbeitung zum Einsatz. Auch im Brückenbau werden Portalkrane im Bereich der Taktschiebeanlage verwendet. |
| Derrickkran | Der Derrickkran ist ein Mastenbaukran, welcher heutzutage kaum noch eingesetzt wird. Er kann besonders hohe Lasten heben und wird in Entladeeinrichtungen im Schiffsbau, Hafenanlagen oder zur Montage im Stahlhochbau eingesetzt. |
| Kabelkran | Kabelkrane bestehen aus einem Seil, welches zwischen zwei Widerlagen gespannt wird. Auf diesem Seil befindet sich eine Katze mit einem Hubwerk. Das Einsatzgebiet von Kabelkranen sind z.B. der Staudammbau oder der Brückenbau über Schluchten. |
| Schwimmkran | Müssen Hubarbeiten auf dem Wasser ausgeführt werden, kommen Schwimmkrane zum Einsatz. Hierbei handelt es sich um Krane, welche auf einem schwimmfähigen Unterteil montiert wird. Beispiele für den Einsatz sind die Vertiefung von Schifffahrtsstraßen, der Bau von Kaianlagen oder der Bau von Pfeilern im Wasserbereich von Brücken. |
| Auslegerdrehkran | Auslegerdrehkrane werden in allen Bereichen der Bauwerkserstellung eingesetzt und sind entweder ortsfeste oder gleisgebundene Turmdrehkrane bzw. gleisunabhängig fahrende Krane (Mobil- oder Fahrzeugkrane). |
Auslegerdrehkran
Im Bauwesen werden vorwiegend Auslegerdrehkrane eingesetzt. Wesentliche Unterscheidungsmerkmale zwischen verschiedenen Auslegerdrehkranen werden folgend dargestellt:
| Standortmobilität | ||
|---|---|---|
| Stationäre Krane | Gleisgebundene Krane | Mobile Krane |
| Bauart | ||
| Untendreher | Der Drehkranz befindet sich direkt oberhalb des Unterwagenrahmens. Der Turm wird bei einer Drehbewegung mitgedreht. Das Gegengewicht befindet sich unten. Unten drehende Krane kommen meist in Form von selbstaufbauenden Schnellmontagekranen vor. | |
| Obendreher | Der Drehkranz befindet sich über dem Turm und unterhalb des Auslegeranlenkpunktes. Der Turm dreht sich nicht mit und der Gegengewichtballast befindet sich gegenüber dem Ausleger oben. Im Unterwagenrahmen befinden sich meist zusätzliche Ballastgewichte. Die Montage erfolgt mit Einzelelementen im Baukastensystem und meist mit Hilfe eines Mobilkrans. | |
| Turmbauart | ||
| Starrer Turm | Turm wird aus mehreren Teilstücken montiert | |
| Teleskopierbarer Turm | Als Gittermast oder als Vollprofil vorhanden | |
| Aufstockbarer Turm | Von unten oder von oben aufstockbar hydraulisch oder mittels Seilzugwinden | |
| Klappbarer Turm | Schnellaufbaukrane mit Gitter oder Vollprofilturm mit 1 oder 2 Gelenkpunkten (Scharnier) | |
| Auslegerart | ||
| Verstellausleger | Vertikal beweglicher Ausleger, mit einem Hubseil an der Auslegerspitze | |
| Laufkatzausleger | In der Regel horizontaler Ausleger | |
| Hubseil wird über eine Laufkatze geführt | ||
| Knickausleger | Kombination aus Verstell- und Laufkatzausleger. Laufkatzenausleger mit Verstellmöglichkeit des Auslegerteils am Auslegeranlenkpunkt des Turms | |
| Teleskopausleger | Ausleger ist ausziehbar und höhenverstellbar | |
| Ausleger mit Kastenprofil | Kein Gitterwerk, sondern aus Blech | |
| Teleskopierbar undter Last | ||
| Klappbar bei der Montage | ||
| Lastabtragung | ||
| Freistehende Krane | Freistehende Krane werden häufig in kleineren Arbeitsbereichen für sich wiederholende und einzigartige Hebeaufgaben eingesetzt | |
| Verankerte Krane | Stationär stehend mit Wandverankerung im Bereich des Turmes (nur bei oben drehenden Kranen möglich) | |
| Kletterkrane | Im Gebäude verankert, meist im Fahrstuhlschacht, im Bauablauf mitkletternd ohne direkten Kontakt zum Boden | |
Vorteil von Turmdrehkranen ist eine exakte horizontale Lastbewegung. Die Last kann dicht bis an den Turm herangefahren werden. Außerdem ist die Lastgeschwindigkeit bei Verfahren der Last konstant, wodurch ein unkontrolliertes Pendeln der Last vermindert wird.
Bei zu schneller Horizontalfahrt der Katze oder beim Drehen kann es jedoch trotzdem zu unkontrolliertem Pendeln der Last kommen. Schnelles Bremsen der Last verursacht zusätzliche Belastung auf den Kran. Ein weiterer Nachteil von Turmdrehkranen ist der bedingt mögliche Einsatz in engen Baulücken mit Hindernissen. Die Turmhöhe muss immer größer als das zu erstellende Bauwerk sein, was ggf. zu großen erforderlichen Turmhöhen führt. Bei dem Einsatz von mehreren Kränen muss beachtet werden, dass die Ausleger unterschiedlich hoch sind, falls ein Überschneidungsbereich vorliegt, um Kollisionen zu vermeiden.
Die folgende Abbildung zeigt exemplarisch einen stationären Untendreher-Kran auf einer Baustelle.
 Abb.1: Stationärer Untendreher-Kran auf einer Baustelle (Quelle: DigiBAU Medien)
Abb.1: Stationärer Untendreher-Kran auf einer Baustelle (Quelle: DigiBAU Medien)
Sonstige Hebezeuge
Fahrzeugkran
Fahrzeugkrane kommen auf der Baustelle ausschließlich als Drehkrane vor. Es handelt sich um Krane, die einen auf dem Unterwagen drehbaren Oberwagen haben.
Bei Fahrzeug-Drehkranen unterscheidet man in folgende Ausführungsformen:
| Ausführungsform | Definition |
|---|---|
| Mobilkran | Mobilkrane sehen den Mobilbaggern ähnlich. Sie haben einen Teleskop‐ oder einen Gitterausleger. Im Unterschied zum Autokran hat der Mobilkran nur einen Motor zum Antrieb von Kran‐ und Fahrbewegung. Mobilkrane haben nur ein Führerhaus und eine Fahrleistung von 25 bis 40 km/h. |
| All-Terrain-Kran | Allterrainkrane sind eine Sonderform der Mobilkrane mit Allradantrieb, kurzen Radständen, großvolumigen Reifen und (veränderbarer) großer Bodenfreiheit zum Einsatz in schwierigem Gelände und auf der Straße. |
| Raupenkran | Raupenkrane sind den Raupenbaggern ähnlich. Sie haben ein Raupenfahrwerk für unwegsames Gelände und in der Regel einen Gitterausleger. Sie haben nur einen Motor und ein Führerhaus. Sie werden für Spezialeinsätze, wie beispielsweise Rammen von Spundwänden, Bohren von Bohrpfahlwänden etc. verwendet. |
| Autokran | Autokrane besitzen als Unterwagen ein LKW‐Fahrgestell oder ein speziell entwickeltes Fahrwerk mit einem separaten Führerhaus für den Fahrbetrieb. Autokrane haben zwei Motoren. Die Motorleistung ist wesentlich höher als die der Mobilkrane. Kleine und mittlere Autokrane haben Teleskopausleger, große Geräte auch Gitterausleger. Autokrane werden meist tageweise angemietet. |
Im Vergleich zu Turmdrehkranen ergeben sich bei Fahrzeugkranen einige Vor- und Nachteile.
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| schnell am Einsatzort und schnell aufgebaut | große Aufstellfläche erforderlich, hohe Bodenpressung unter den Abstützungen |
| stromunabhängig | großes Eigengewicht |
| hohe Lasten bei großen Auslegerentfernungen möglich | großer Drehradius beim Fahren |
| keine Kranbahn oder spezieller Stellplatzunterbau erforderlich | Arbeitsbewegungen des Auslegers wie beim Verstellausleger |
| große Hubhöhe, Verlängerungen möglich | Fahren unter Last nicht möglich (Ausnahmen) |
| Bewegungen langsamer als bei TDK | |
| Baustraße für den Transport erforderlich | |
| teuer in der Miete |
Bauaufzüge
Bauaufzüge dienen dem vertikalen Transport von Lasten oder Lasten und Personen, überwiegend an Außenfronten bestehender Gebäude. Sie sind für den vertikalen Transport in größere Höhen ausgelegt und entlasten bzw. ersetzen damit Krane. Es können gezielt einzelne Etagen eines Bauwerkes angefahren und diese insbesondere mit Material und Kleingeräten versorgt werden.
Bei Bauaufzügen unterscheidet man in folgende Varianten:
| Bezeichnung | Definition |
|---|---|
| Schrägaufzug | Bei Schrägaufzügen handelt es sich um leichte Bauaufzüge mit einer Tragkraft bis ca. bis 200 kg, die meist auf einem Anhänger montiert sind. Schrägaufzüge werden überwiegend für Dachdeckerarbeiten oder Möbeltransporte verwendet. |
| Material-Senkrechtaufzug | Bei Material‐Senkrechtaufzügen handelt es sich um Bauaufzüge mit einer Tragkraft bis ca. 1.500 kg. Aufzüge für größere Lasten werden häufig am Außengerüst montiert und erreichen eine maximale Hubhöhe bis 100 m. Sie haben eine Hubgeschwindigkeit von bis zu 30 m/min. Diese Aufzüge werden überwiegend von Gerüstbauern und Ausbauhandwerkern verwendet. |
| Personen und Material-Senkrechtaufzug | Bei Personen und Material‐Senkrechtaufzügen handelt es sich um Bauaufzüge mit einer Tragkraft bis ca. 4.500 kg. Sie werden fest am Gebäude oder Außengerüst montiert und haben eine Hubgeschwindigkeit von bis zu 90 m/min. Bei der Personenbeförderung muss die Fahrkabine vollkommen geschlossen sein; es muss eine Betriebserlaubnis beantragt werden. |
Bei Bauaufzügen sollten folgende Anforderungen beachtet werden:
- Die Aufstellung von Bauaufzügen muss auf ausreichend tragfähigem Untergrund erfolgen
- Die Übergänge zwischen höher gelegenen Haltepunkten und dem Fahrkorb sind besonders gegen Absturz zu sichern
- Beim Transport von Personen bestehen höhere Anforderungen an die Ausstattung des Aufzuges; der Aufzug muss eine entsprechende Zulassung aufweisen.
Begriffserläuterungen
Der waagerechte Abstand der Kranachse vom Hubseil in die äußerste Position wird als Ausladung [m] bezeichnet. Die Tragkraft [kg bzw. t] entspricht der Nutzlast einschließlich Sicherheitszuschlägen und ist abhängig von der jeweiligen Auslegerstellung. Das Lastmoment [t * m] ergibt sich aus dem Produkt von Ausladung und der zugehörigen Nutzlast. Über die gesamte Auslegerlänge ist das Lastmoment ungefähr konstant. Es ist die maßgebliche Kenngröße von Kranen in der BGL (Baugeräteliste). In einem Traglastdiagramm kann die proportionale Darstellung der Tragkraft in Abhängigkeit von der Stellung des Kranhakens über die gesamte Auslegerlänge erfolgen.
Der senkrechte Abstand von der Oberkante des Geländes bis zur Unterkante des Lasthakens in höchster Stellung wird als Hakenhöhe [m] oder Hubhöhe bezeichnet. Das Konstruktionsgewicht [t] des Krans ergibt sich aus dem Gesamtgewicht des Krans ohne Ballast und wird ebenfalls in der BGL angegeben.
Um die Standfestigkeit eines Krans zu gewährleisten, werden Ballast-Gewichte [t] am Kran angeordnet. Der Gesamtballast setzt sich zusammen aus Zentralballast und Gegenge-wichtsballast am drehbaren Teil des Krans.
Die Befestigungsstelle des Auslegers am Turm wird als Auslegeranlenkpunkt bezeichnet. Die maximale Ausladung des Krans im Grundriss wird als Auslegerradius [m] bezeichnet, währen der Radius des Krans im Bereich der Drehbühne unten bei unten drehenden Kranen als Drehradius [m] benannt wird.
 Abb.2: Exemplarischer Aufbau eines oben drehenden Krans am Beispiel eines Laufkatzauslegerkrans
Abb.2: Exemplarischer Aufbau eines oben drehenden Krans am Beispiel eines Laufkatzauslegerkrans
 Abb.3: Exemplarischer Aufbau eines unten drehenden Krans am Beispiel eines Nadelauslegerkrans
Abb.3: Exemplarischer Aufbau eines unten drehenden Krans am Beispiel eines Nadelauslegerkrans